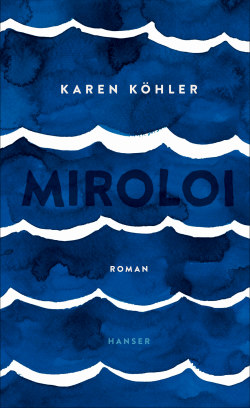
„So eine wie ich ist hier eigentlich nicht vorgesehen.“ Karen Köhlers erster Roman – über eine junge Frau, die sich auflehnt. Gegen die Strukturen ihrer Gesellschaft und für die Freiheit
Ein Dorf, eine Insel, eine ganze Welt: Karen Köhlers erster Roman erzählt von einer jungen Frau, die als Findelkind in einer abgeschirmten Gesellschaft aufwächst. Hier haben Männer das Sagen, dürfen Frauen nicht lesen, lasten Tradition und heilige Gesetze auf allem. Was passiert, wenn man sich in einem solchen Dorf als Außenseiterin gegen alle Regeln stellt, heimlich lesen lernt, sich verliebt? Voller Hingabe, Neugier und Wut auf die Verhältnisse erzählt Miroloi von einer jungen Frau, die sich auflehnt: Gegen die Strukturen ihrer Welt und für die Freiheit. Eine Geschichte, die an jedem Ort und zu jeder Zeit spielen könnte; ein Roman, in dem jedes Detail leuchtet und brennt.
DTV
12,90
Eselshure. Schlitzi. Nachgeburt der Hölle. Ich war schon von Anfang an so hässlich, dass meine eigene Mutter mich lieber hier abgelegt hat, statt mich zu behalten. So eine wie ich, sagen sie, so eine kann nicht von hier sein, so hässlich ist hier niemand, solche Mütter gibt’s hier nicht. Sie sagen, in einen Karton voller Zeitungspapier hat sie mich gelegt, die eigene Mutter, wie Müll, den man zum Müll legt. Den Karton, sagen sie, hat sie auf eine Stufe der Treppe zum Bethaus gestellt. Mitten in der Nacht, mitten im Regen, mitten im Winter. Was für eine Mutter, sagen sie, was für eine Sünde, und schauen nach oben dabei, das ganze Dorf hat sie damit befleckt. Und dass ich von drüben bin, das ist ja offensichtlich, und dass von dort seit jeher nur Schlechtes gekommen ist. Und sie machen diese Bewegung mit der Hand, die sie immer machen, wenn sie klagen. So eine wie mich, sagen sie, so eine hätten sie weggemacht.
Und ich mach mich weg, jeden Tag mach ich mich weg. Jetzt gerade, mit dem Einkaufsnetz in der Hand, mach ich mich weg, weil: Eselshure. Schlitzi. Nachgeburt der Hölle. Das rufen mir die Kinder hinterher, das war noch nie anders, die Worte waren schon immer da, nur die Kinder sind immer andere Kinder, sie wachsen stets wieder nach und folgen mir als schimpfende Traube durchs Dorf auf dem Weg vom Laden hoch zum Bethaus. Und wegen der Sache mit meinem Bein kann ich nicht schnell, und das wissen sie nur zu gut.
Ich mach mich also weg, drehe die Welt einmal um und setze mir die Schimpftirade als Krone auf, bis die Kinder von mir ablassen, weil in der Kurve beim Brunnen die alten Frauen auf ihren Stühlen sitzen und die jetzt dran sind. Alle in Schwarz, alle ganz starr, alle ganz Auge, stumm, verschlossen, zu. Und wie sie gucken und zischeln und mit den Mundwinkeln zucken, als ich auf ihrer Höhe bin. Und Handbewegungen, und Himmelwärtsblicke. Ich weiß nicht warum, weiß nicht, was heute anders ist, vielleicht bin ich voll wie ein Gefäß, in das nichts mehr hineinpasst, kein Blick, kein Zischeln, kein Schnalzen mehr. Vielleicht ist es, weil ich blute und mich alles leichter reizt, aber heute bleibe ich vor den Frauen stehen, hebe meinen Blick und schaue zurück. Eine nach der anderen schaue ich mir an, ganz langsam schaue ich direkt in ihre Gesichter. Sie sind die Ältestenfrauen, sie ziehen sich das Leid der Anderen an wie ein Gewand, das ihnen ganz genau passt. Sie sind die Klageweiber, die über unsere Leichen gebeugt weinen, sich die Zöpfe lösen und die Haare raufen. Sie sind die Lebensgeschichtenbewahrerinnen, die nach deinem Tod dein ganzes Leben besingen. Sie sind die Mütter, Groß- und Urgroßmütter des Dorfes, von Regeln gebeugt, vom Leid verzerrt, vom Alter verrunzelt, von Arbeit, Krankheit und Dreck zermürbt, von Hass und Missgunst zerfressen. Ich sehe sie mir an. Sehe sie mir ganz genau an.
